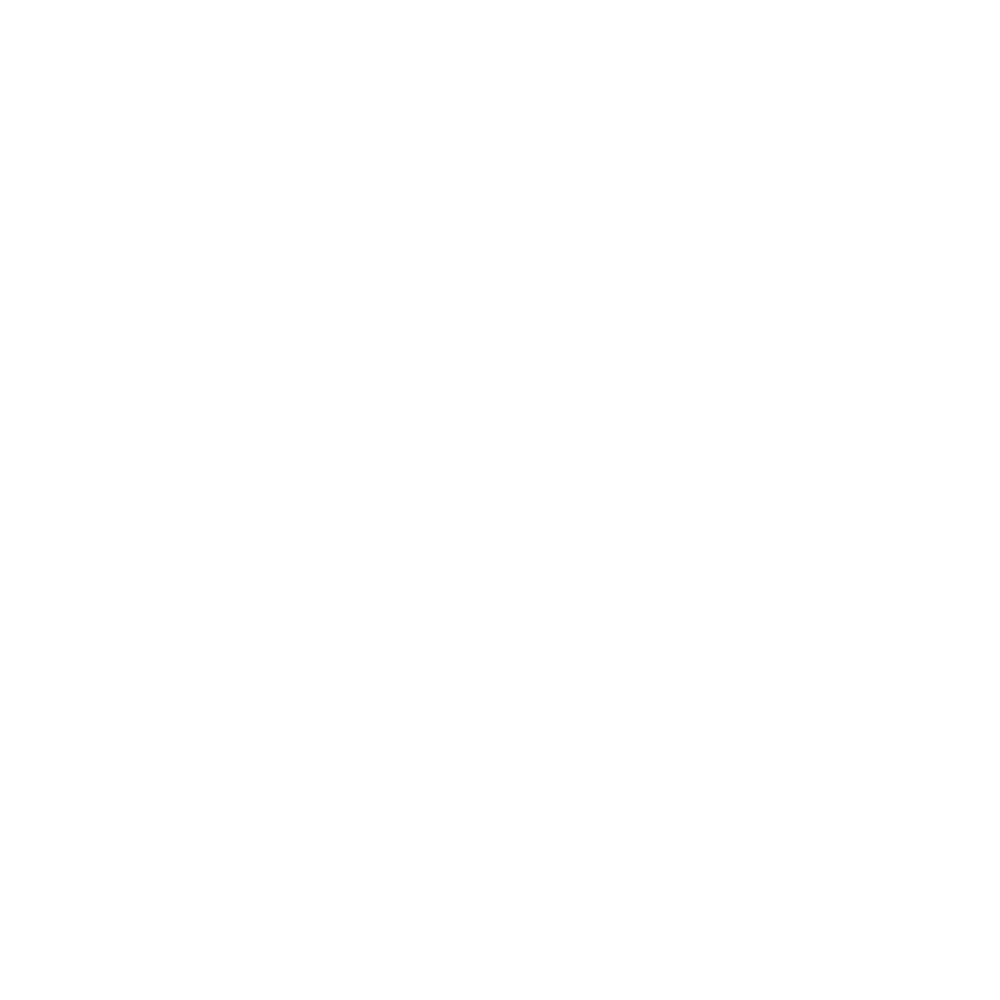Komplexität ist längst kein Schlagwort mehr, vielmehr ist sie ist dein Alltag.
Ziele verschieben sich, kaum dass sie vereinbart sind. Strategien laufen ins Leere. Märkte verändern sich über Nacht. Mitarbeitende suchen Orientierung und gleichzeitig suchst auch du selbst nach Halt in diesem Strudel widersprüchlicher Erwartungen.
Es fühlt sich an, als würdest du in einem kleinen Boot sitzen: Die Wellen neuer Technologien, politischer Umbrüche und unterschiedlicher Interessen schlagen von allen Seiten gegen die Bordwand.
Rudern? Treiben lassen? Kurs wechseln? Genau so erleben viele heute Komplexität.
Komplexität im Berufsalltag
- Als Führungskraft: Du willst motivierend und umsichtig handeln und gibst klare Ziele vor. Doch sobald du sie aussprichst, ändern sich die Rahmenbedingungen: Marktprognosen verschieben sich, neue Prioritäten kommen „von oben“. Und plötzlich wirken deine Entscheidungen im Team nicht mehr richtig oder konsistent.
- Als interne:r Berater:in: Du beobachtest, wie Meetings immer länger dauern und Probleme wie Ping-Pong hin- und hergeschoben werden. Fachbereiche blockieren sich gegenseitig, statt gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Dein Eindruck: alle stehen sich selbst im Weg. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil die Zusammenhänge zu komplex sind.
- Als Unternehmer:in: Du wünschst dir, dass alle an einem Strang ziehen und dein Unternehmen nachhaltig gestalten. Doch die Realität: Vertrieb denkt in Quartalszahlen, Produktion kämpft mit Lieferengpässen, HR sucht händeringend Fachkräfte. Nachhaltigkeit steht auf allen Folien. Doch im Alltag zieht die operative Hektik die Aufmerksamkeit ab.
- Als Young Talent: Du denkst: „Eigentlich ist die Lösung doch offensichtlich.“ Doch sobald du deinen Vorschlag machst, merkst du: andere Abteilungen haben ganz andere Perspektiven, Interessen oder Abhängigkeiten. Aus „einfach“ wird ein Geflecht, in dem jede Bewegung neue Fragen aufwirft.
Ein Modell, das Komplexität einordnet
Der Managementforscher Dave Snowden hat mit dem Cynefin-Modell beschrieben, wie wir Probleme einordnen können:
- Im komplexen Feld suchen wir experimentell nach Mustern.
- Im komplizierten Feld können wir Expert:innen befragen und Wahrscheinlichkeiten nutzen.
- Erst wenn wir genügend Erkenntnisse gewonnen haben, lassen sich Dinge ins einfache Feld überführen – dort genügen klare Regeln.
Snowdens Befund: Viele Fehler entstehen, weil Komplexität als „einfach“ behandelt wird.
Für Führungskräfte, Berater:innen und Unternehmer:innen bedeutet das: Wenn wir vor komplexen Fragen stehen, benötigen wir ein völlig anderes Handwerkszeug, als wir es aus dem klassischen Business-Alltag gewohnt sind. Statt schneller Antworten geht es um Mustererkennung, Experimente und das Akzeptieren von Unsicherheit.
Warum das Thema so relevant ist
Komplexität ist auch ein Treiber für New Work. Selbstorganisierte Teams gelten als leistungsfähiger und innovativer, wenn die Menschen befähigt werden, sich selbst zu führen.
Fehlt diese Fähigkeit, kippt die Selbstorganisation in Überforderung. Denn: mehr Interaktionen, mehr Spannungen, wechselnde Führungsrollen: All das ist komplexer, aber auch chancenreicher.
Innere Ressourcen als Antwort
Wenn die äußere Welt immer komplexer wird, brauchen wir innere Ressourcen, um uns selbst wirksam zu steuern.
- Achtsamkeit und Präsenz: Wahrnehmen, was ist, ohne sofort in Aktionismus zu verfallen.
- Systemische Haltung: Kontexte berücksichtigen, Situationen differenziert betrachten und verstehen, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt.
- Persönliche Stärken: Erkennen, was uns trägt und wie wir authentisch handeln.
- Resilienz und Selbstwirksamkeit: Vertrauen entwickeln, auch in unsicheren Situationen handlungsfähig zu bleiben.
- Werte und Haltung: Werte anderer wahrnehmen und als Bedürfnisse oder Notwendigkeiten begreifen.
- Integration von Gegensätzen: Stabilität und Veränderung denken, Vielfalt als Chance sehen.
Selbstführung – je nach Rolle unterschiedlich, und doch für alle zentral
Selbstführung bedeutet, das eigene SELBST mit Hilfe des ICH zu erkunden. Es sind Bedürfnisse und Werte zu erkennen, Prioritäten zu setzen und in Verbindung mit anderen handeln. Je nach Rolle zeigt sich das unterschiedlich:
- Führungskraft: Selbstführung heißt, den eigenen Standpunkt zu kennen, Ambivalenzen auszuhalten und Mitarbeitenden Orientierung zu geben, auch wenn die Richtung nicht eindeutig ist.
- Berater:in: Selbstführung heißt, innere Klarheit zu bewahren, während du Organisationen durch unübersichtliche Veränderungsprozesse führst und dabei den eigenen Einfluss realistisch einzuschätzen.
- Unternehmer:in: Selbstführung heißt, Prioritäten zu setzen, Ressourcen bewusst einzuteilen und das Unternehmen an Werten und Visionen auszurichten, ohne dich von täglicher Unruhe verschlingen zu lassen.
Selbstführung ist dabei immer auch eine Lebensaufgabe: Jede Lebensphase stellt neue Fragen, jede Generation bringt eigene Antworten mit. Gerade im Austausch zwischen den Generationen liegt ein großes Potenzial. Wir können voneinander lernen und so Vielfalt zu einer echten Stärke machen. Komplexität verlangt zudem nach innovativen Ideen und nach Eindrücken aus dem Netzwerk, die wir nur dann nutzen können, wenn wir sie mit Offenheit und ohne vorschnelles Urteil wahrnehmen.
Fazit
Komplexität erleben wir im Außen, aber sie fordert uns in erster Linie im Inneren.
Nur wenn wir uns selbst führen, können wir mit Klarheit handeln, ohne uns von Widersprüchen überwältigen zu lassen.